
Prof. Dr. phil. Michael Josef Maria Birkenbihl war der Großvater von Vera F. Birkenbihl. Am 23. Juni 1877 in einer der ältesten Ecken der fränkischen Residenzstadt Würzburg geboren, der Eichhorngasse (heute: Eichhornstraße), besuchte der Sohn des Kürschners und Pelzhändlers Gustav Birkenbihl in seiner Geburtsstadt das humanistische Königliche Neue Gymnasium, das er am 14. Juli 1897 mit dem Abitur abschloss.
Obwohl Würzburg mit der Julius-Maximilians-Universität die älteste Hochschule Bayerns besaß (die weltweit für ihre Forschung und Lehre einen sehr guten Ruf genoss und auch heute noch genießt) entschloss sich JMJ Birkenbihl dazu, mitten in der sog. „Bayerischen Prinzregentenzeit“ ins weit entfernte Baden nach Freiburg im Breisgau, der südlichsten Großstadt des Kaiserreichs, zu gehen und dort Medizin zu studieren. Doch nach nur zwei Semestern brach brach er dies ab und ließ sich zuerst in Heidelberg und danach in München immatrikulieren, um deutsche Sprache und Literaturgeschichte zu studieren. Birkenbihl arbeitete intensiv daran, den fränkischen Dialekt abzulegen, da er humanistische Vortäge über verschiedenste Themen halten wollte, was ihm schließlich auch gelang. Schwieriger war es da für ihn, seinem Vater beizubringen, dass er nicht gedenkt, später einmal dessen Pelzhandel nebst Ladengeschäft zu übernehmen.

Im Oktober 1901 bestand Michael Birkenbihl sen. in München den ersten Abschnitt der Lehramtsprüfung für Deutsche Sprache, Geschichte und Geographie, verfasste 1905 eine Dissertation über das Thema „Georg Friedrich Daumer (Beiträge zur Geschichte seines Lebens und seiner westöstlichen Dichtungen)“ (dies wurde auch seine erste Publikation) und wurde dafür promoviert; interessanterweise war Daumer ebenso wie Birkenbihl Franke und zudem auch Sohn eines Kürschners und Rauchwarenhändlers. Im höheren Schuldienst unterrichtete Michael Birkenbihl sen. jedoch nicht „klassisch“ an den Münchner Universitäten LMU und TH sondern an der als Neugründung der Technischen Hochschule angeschlossenen Handelshochschule als Professor (siehe unten), zu dem er nach einer Probevorlesung im Mai 1913 berufen wurde. Zu Beginn der Weimarer Republik hatte es Prof. Dr. JMJ Birkenbihl als Philosoph und Lehrer sowie Buchautor von Erzählungen, Novellen und Biografien und darüber hinaus als Übersetzer in München zu einer gewissen Bekanntheit und zu Ansehen gebracht. Bis zu seinem Lebensende blieb er der bayerischen Landeshauptstadt verbunden und hielt nur noch sporadisch Kontakt nach Würzburg.
Wirken als Schriftsteller und Autor
Aus literarischer Sicht schuf Michael Josef Maria Birkenbihl mit „Der Madonnenmaler (Eine Novelle aus der Zeit des Achtzigjährigen Krieges)“ [1905] und „Vorwärts durch eigene Kraft. Lebensbilder berühmter Männer“ [1914] erfolgreiche Bücher, denen er kurz nach dem Ende des 1. Weltkriegs „Dämonische Novellen“ [1919] und „Novellen der Leidenschaft“ [1921; ursprünglich: „Im Taumel des Lebens“] folgen ließ. Als Übersetzer arbeitete Vera F. Birkenbihls Großvater zunächst an Hans Christian Andersens Autobiografie „Das Märchen meines Lebens“, dann übersetzte er verschiedene „Nordische Volksmärchen“. 1912 war er Herausgeber der Heinrich von Kleist Novelle „Michael Kohlhaas“, die, anders als seine überwiegend im Münchner Großraum veröffentlichten anderen Bücher, im Dresdner Ehlermann Verlag erschien.
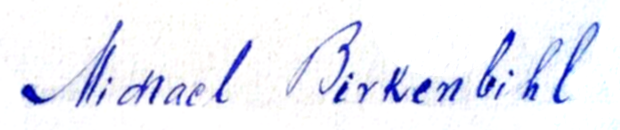
Im Münchner Verlag J. Michael Müller erschien Ende 1920 das Werk „Les Fables d‘ Esope Phrygien. Illustrées de discours moraux, philosophiques, et politiques. Nouvelle Edition“ (ein Nachdruck der sog. „Brüsseler Ausgabe 1669“ von Francois Foppens). Für diese exquisite Neuauflage zeichnete er ebenso verantwortlich, wie für das Nachwort.
Später, als er in der Ungererstraße 64 in München-Schwabing wohnte, wandte sich Prof. Birkenbihl kleineren Veröffentlichungen zu, publizierte etwa im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel Artikel über „Friedrich König (dem Erfinder der Schnellpresse zu seinem 100. Todestage 1933)“, „Zum 100. Todestage Aloys Senefelders (dem Erfinder der Lithographie)“ oder über Johann Philipp Palm, einem Nürnberger Buchhändler, der auch als „Märtyrer der Pressefreiheit“ bezeichnet wurde.
Der russische Maler und Kunsttheoretiker Wassily Kandinsky, der selbst einige Jahre in Schwabing lebte, schrieb einst über den (Zitat) »etwas komischen, ziemlich exzentrischen und selbstbewußten« Stadtteil: »Schwabing, in dessen Straßen ein Mensch … ohne Palette oder ohne Leinwand oder zumindest ohne eine Mappe sofort auffiel (…) Alles malte oder dichtete oder musizierte oder fing zu tanzen an. In jedem Haus fand man unter dem Dach mindestens zwei Ateliers, wo manchmal nicht gerade so viel gemalt, aber stets viel diskutiert, disputiert, philosophiert und tüchtig getrunken wurde.«
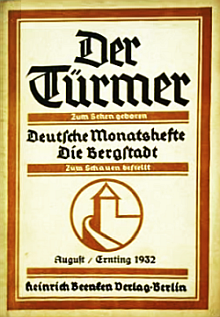
In „Der Türmer (Deutsche Monatshefte)“ veröffentlichte Prof. Birkenbihl in den 1930er Jahren aber auch ganz andere Texte, beispielsweise Texte über „Die deutsche Küche“, im „Fach- und Wirtschaftsblatt für die Silikat-Industrie“ erschien 1938 eine vierteilige Artikel-Serie von ihm über „Entwicklungsstufen der deutschen Kachel“ oder es gab Abhandlungen über „Deutsche Zier- und Prunkgitter“. 1921 wurde ihm als bereits über 50-Jähriger inmitten seiner schöpferischsten Phase als Autor und Schriftsteller als einziges Kind sein Sohn Michael Birkenbihl jun. geboren, 1946 erblickte seine Enkelin Vera Felicitas das Licht der Welt. Bis zu seinem Tode lag ihm seine Enkelin am Herzen; ihr empfahl er Anfang 1960 die sog. „Methode Mertner“ zum Fremdsprachen erlernen, die ihm durch seine Münchner Freunde Dr. phil. Rudolf Ziegler und Dr. phil. Karl Müller bekannt war.
Als JMJ Birkenbihl am 28. November 1960 im Alter von 83 Jahren nach längerer Krankheit an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb, hinterließ er Sohn und Enkelin eine Erbschaft, die es beiden ermöglichte, 1965 in die USA zu gehen und dort zu studieren bzw. Studien durchzuführen. Dass aus beiden Nachkommen „große Namen“ auf ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern wurden, konnte er nicht mehr miterleben, aber es hätte ihn mit Sicherheit stolz gemacht – und Michael jun. als auch Vera Felicitas haben ihre Erfolgskarrieren ja auch auf gewisse Weise ihm und den Früchten seines Schaffens zu verdanken. Prof. Dr. phil. Michael Josef Maria Birkenbihl hatte das Kaiserreich erlebt, zwei Weltkriege überlebt, dazwischen in der Weimarer Republik gelebt und die Nazi-Zeit ertragen, hatte auch noch die aufstrebende Bundesrepublik gesehen und sich in allen irgendwie zurechtgefunden, ohne seine humanistische Sicht auf die Welt zu verlieren. Und das hatte sich nachhaltig auf die beiden anderen Birkenbihls ausgewirkt.
Nebenbei bemerkt: Im Werk von Wilhelm Kosch „Deutsches Literatur-Lexikon des 20. Jahrhunderts“ findet man in Band 2 auf Seite 675 eine Kurzübersicht von ihm veröffentlichter Bücher, Artikel und Essays!

Die Handelshochschule München
Quelle: Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln, vorgelegt 2004 von Diplom-Volkswirt Gunther Herbert Zander
(…) Die Handelshochschule in München wurde zum Wintersemester 1910/1911 unter der Trägerschaft des Münchener Handelsvereins und der Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern sowie mit Unterstützung der Stadtgemeinde München gegründet. Die offizielle Eröffnung erfolgte am 4. Oktober 1910. Zu einem Förderer der Münchener Handelshochschule entwickelte sich im Laufe der Bestrebungen der zunächst skeptische technische Leiter des Münchener Schulwesens, Georg Kerschensteiner. Die Gründungsbestrebungen standen in Konkurrenz zu den Nürnberger Bemühungen, die einzige Handelshochschule in Bayern errichten zu wollen. (…)
Die Münchener Gutachter hielten eine besondere Abteilung für Handelswissenschaften an der TH München, eventuell in Verbindung mit bereits an der Universität vorhandenen Fächern für ausreichend, weil bereits Handelslehrer an der TH ausgebildet würden. Sollte eine Handelshochschule nach Kölner Muster errichtet werden, dann sollte diese aber in München gegründet werden. In der Bayerischen Abgeordnetenkammer wurden dann am 20. Mai 1904 20.000 Mark genehmigt, um zu prüfen, ob in Nürnberg eine zweite bayerische Technische Hochschule mit einer angegliederten Handelshochschule errichtet werden sollte. (…) Ganz generell waren die Professoren der TH München aber der Ansicht, dass die Initiative in dieser Frage vom Handelsstand ausgehen sollte und der Abschluss einer neunklassigen Mittelschule, d.h. das Abitur, die Aufnahmevoraussetzung darstellen müsse. (…)
Von den sechs angeschriebenen Handelskammern sprachen sich die Handelskammern in Passau, Regensburg und Augsburg ausschließlich für München als Sitz einer Handelshochschule aus und Ludwigshafen und Bayreuth sowohl für München als auch für Nürnberg. (…) Im Mai 1909 stellte Staatsminister Dr. Freiherr von Podewils-Dürniz letztendlich fest, dass sich aus Sicht der Regierung die Gründe für die Wahl Münchens oder Nürnbergs als Sitz einer künftigen Handelshochschule die Waage hielten. Zwei Monate später genehmigte das Unterrichtsministerium den Stadtmagistraten München und Nürnberg offiziell ihre Errichtungsanträge. (…) Am 30. April 1910 wurde der Vertrag über den Unterhalt der Handelshochschule in München von dem Bürgermeister der Stadt München für den Magistrat, vom Präsidenten der Handelskammer München und der Vorstandschaft des Münchener Handelsvereins unterzeichnet. Die endgültige staatliche Genehmigung zur Errichtung der Handelshochschule in München zum Wintersemester 1910/1911 erfolgte am 24. Juli 1910 mit einigen Auflagen bezüglich der eingereichten Satzung. Am 4. Oktober 1910 wurde die Handelshochschule eröffnet.
Für angehende Handelsschullehrer gab es in Bayern bereits einen geregelten Ausbildungsweg. Es war allerdings beabsichtigt, später ebenfalls wie an der TH München ein Abschlussexamen für Handelslehrer und –lehrerinnen einzuführen, um Staatsexamen für Lehrer der Handelswissenschaften auch an der Handelshochschule abgelegen zu können. (…) Im ersten Semester 1910/1911 waren 102 Studierende sowie 365 Hörer und Hospitanten eingeschrieben, von den letzteren stammten 57 von der TH München oder der Universität. (…) Nicht nur die Wirtschaftskrise brachte die Handelshochschule als selbständige Institution zu Fall, sondern vielmehr die von Beginn an nicht längerfristig gesicherten finanziellen Grundlagen. Diese waren auch ein Ergebnis des Wettbewerbs mit Nürnberg, weil dadurch die Unterstützung des Bayerischen Industriellenverbandes dauerhaft verloren ging. Weitere private Sponsoren wie an den meisten anderen Handelshochschulstandorten traten nicht auf. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Handelsvereinigungen auch noch nach Gründung der Hochschule insgeheim mit staatlicher Unterstützung rechneten. Bereits ab dem Ersten Weltkrieg wurden einige Lehrstühle nicht mehr besetzt, um eine leichtere Überführung oder Abwicklung der Handelshochschule zu ermöglichen, so dass beider Überführung der Handelshochschule an die TH in München nur noch drei hauptamtliche Dozenten angestellt waren. (…)
Ergänzung von BIRKENBIHL SAMMLUNG & ARCHIV: Dr. M. J. M. Birkenbihl wurde 1913 nach Dr. M. J. Bonn, Dr. E. Jaffé und Dr. H. Hanisch als einer der ersten Professoren der Handelshochschule München berufen.